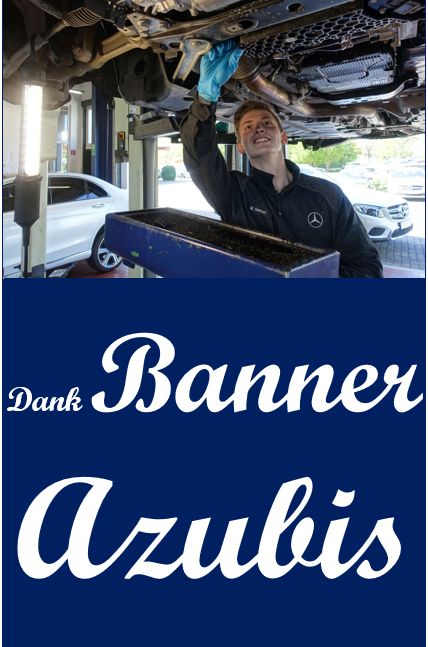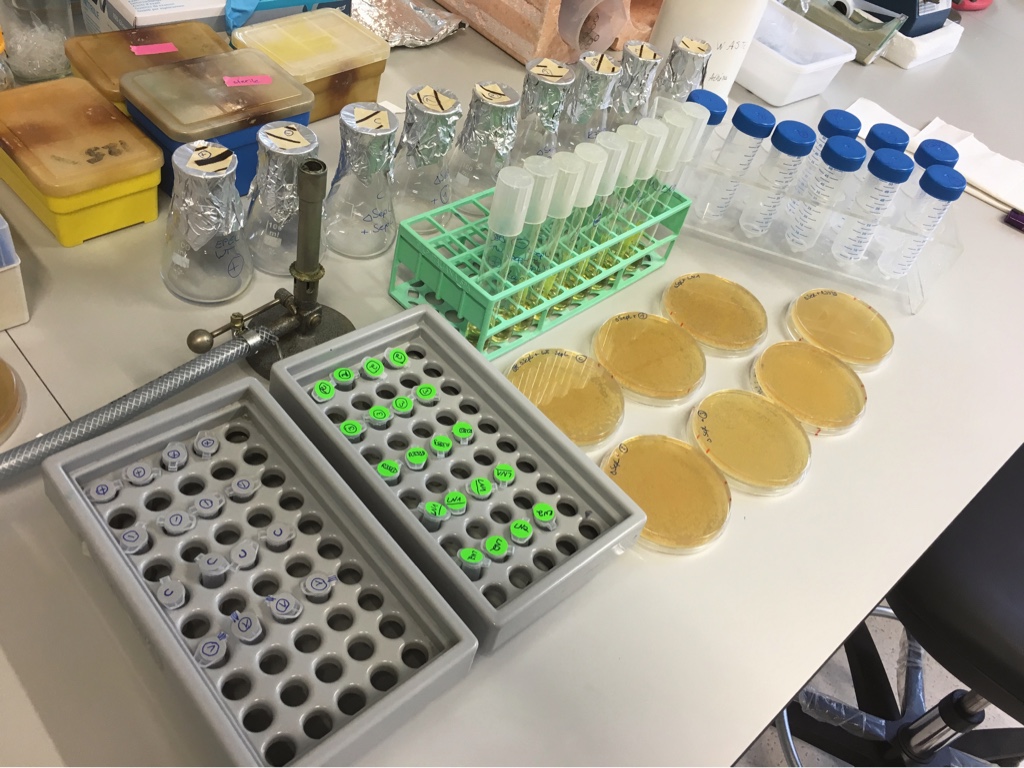Als ältester von drei Kindern erblickte ich am 21.August 1927 das Licht der Welt. In Beuthen, Oberschlesien, damals eine blühende Industrieregion, wuchs ich auf. Die Grenze zu Polen war nur ungefähr zwei Kilometer entfernt. Ich war gerade mal 12 Jahre alt, als am 1.September 1939 der Krieg begann. Meine kleine Schwester, damals 1 ½ Jahre alt, lag an diesem Abend angezogen in ihrem Kinderwagen, das Gepäck stand direkt daneben und wir alle lagen in Straßenkleidung in unseren Betten. Die Männer im Dorf hatten ihre Kleinkaliberwaffen schussfertig bereitliegen. Es lag eine nicht gekannte und unheimliche Spannung in der Luft.
Schon Wochen zuvor hatte die Mobilmachung begonnen. Soldaten wurden in unsere Schule einquartiert. Der Unterricht fiel einige Tage zu unserer aller Freude aus, konnten wir doch als Pimpfe nicht ahnen, was uns der Krieg an Leid und Entbehrung noch bringen würde.
Der Kriegsbeginn lief bei uns recht unspektakulär ab. Bereits am nächsten Morgen schien der Spuk vorbei und der Schulunterricht begann wieder.
Zum 1. Juli 1943 sollte sich das ändern. An diesem Tag wurde ich als Flakhelfer einberufen. In der so genannten Heimatflak hatten wir die Aufgabe, das Industriegebiet gegen Luftangriffe aus Russland, von den Amerikanern und den Engländern zu schützen.
Nach und nach änderte sich unser Tagesablauf. Vormittags in die Schule, nachmittags waren wir als Flakhelfer eingesetzt. Wobei natürlich die Schule ausfiel, sobald wir alarmiert wurden. Dann stürmten wir aus dem Schulgebäude, hielten mit unseren knapp 17 Jahren die nächste Straßenbahn an und gaben dem Schaffner den Befehl, uns an die Flakstellung zu fahren.
Dann wurden wir in das Gebäude der Ingenieurschule nach Kattowitz versetzt. Wir waren im obersten Stockwerk untergebracht. Von dort fiel unser Blick aus dem Klassenzimmer immer wieder auf die Rohre der dortigen Flakgeschütze. Sobald diese in den Himmel zeigten, wussten wir, dass wir gleich zum Einsatz gerufen würden. Dann fingen wir schon an, unsere Bücher und Federhalter einzupacken. Wir, die Soldaten, eilten zum Kriegseinsatz, die anderen Schüler durften sich über einen vorgezogenen Schulschluss freuen.
Grundsätzlich hatten wir auch zu dieser Zeit unseren Stundenplan in der Schule. Dieser jedoch war immer abhängig von der so genannten Feindeslage. Die Verteidigung hatte immer oberste Priorität. Bei Einsätzen nach 24 Uhr begann der Unterricht zwei Stunden später. Nach und nach dünnten sich die Unterrichtsfächer aus. Englisch als „Feindessprache“ wurde nicht mehr gelehrt, auch auf Religion wurde verzichtet. Schließlich sei Religion kein kriegsnotwendiges Fach, hieß es. Dafür lasen wir Cäsar, Tacitus in Latein, Goethe und Schiller im Deutschunterricht, statt Englisch lernten wir Althochdeutsch.
So beschränkte sich also der Unterricht auf Deutsch, Mathematik, naturwissenschaftliche Fächer und Latein. In den einzelnen Baracken der Flakbatterien waren immer die Klassenkameraden miteinander untergebracht. Es fand bereits damals eine moderne Arbeitsteilung unter uns statt. Einer war in Latein der Beste, einem anderem fiel Mathematik leicht usw. So machte jeder die Hausaufgaben, die ihm besonders leicht fielen. Und die anderen schrieben fleißig ab.
Nur alle 14-Tage, an den Samstagen, durften wir nach Hause. Die Verpflegung war immer ausgewogen und reichlich. Natürlich freuten sich unsere Familien, wenn wir nach Hause kamen. Zum einen über uns, aber auch über das sogenannte Kommissbrot, das wir uns ohne Probleme zur Seite legen konnten und das leuchtende Augen in den hungrigen Gesichtern unserer Familien zauberte. Im Oktober 1944 erhielten wir unser so genanntes Kriegsabiturzeugnis und die sogenannte Vorsemesterbescheinigung ausgehändigt.
Unsere Lehrer waren durchweg menschlich. Sie haben uns akzeptiert und hatten aus heutiger Sicht durchaus Verständnis für unsere Situation. Ich denke gerne an einen Pfarrer, der mit seinen 80 Jahren bei uns unterrichtete. Waren wir mit der uns zugeteilten Note nicht zufrieden, wurde eine kurze Frage gestellt, die in der Regel leicht zu beantworten war. Eine Einigung auf die bessere Note war somit vorprogrammiert. Noten waren wohl wichtig, jedoch stritten unsere Lehrer nicht um das letzte Zehntel. Probleme gab es eher mit den aktiven Soldaten. Diese wollten uns doch des Öfteren schleifen. Allerdings hatten wir eine gute Kameradschaft. Den einen oder anderen „Schleifer“ konnten wir sogar in seine Schranken weisen. Irgendwann hakten wir uns beim Befehl „Sprung auf Marsch, Marsch“ gegenseitig unter die Arme und liefen in provokantem gemütlichem Schritt dem Horizont entgegen. Die darauf folgende Beschwerde unseres Vorgesetzten wurde von unserem Batteriechef unter den Tisch gekehrt. Das war schon ein ziemlich gefährliches Verhalten. Aber es tat uns unheimlich gut. Unserer jugendlichen Unbekümmertheit schreibe ich dieses Verhalten heute zu. Was uns hätte blühen können, hatten wir damals wohl verdrängt. Ende 1944 wurde ich zum Arbeitsdienst abkommandiert. Nach nur zwei Monaten, am 9. Januar 1945, wurde ich als Offiziersanwärter eingezogen. Die Aufnahmeprüfung zuvor war ungemein schwer. In Wien fanden die dreitägigen Tests statt. Sowohl sportlich als auch geistig wurde einiges von uns abverlangt. Selbst gesellschaftliche Etikette wurde geprüft, auch dies wurde von einem Offiziersanwärter damals erwartet. Ich erinnere mich, wie wir Speisen gereicht bekamen, die viele von uns noch nicht einmal vom Namen her kannten. Es wurde beispielsweise geprüft, ob wir den uns aufgetischten Fisch richtig entgräteten. Die Finger hierzu zur Hilfe zu nehmen, war natürlich nicht gestattet. Unrichtiges Verhalten führte zum Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung. Jedenfalls bestand ich die Prüfung erfolgreich.
Am 7. Mai 1945 hatte ich bei Magdeburg meinen letzten Kriegseinsatz gegen die russische Armee. Die Amerikaner waren schon an der Elbe. Wir zogen uns zurück und ergaben uns den Amerikanern. Bereits am nächsten Tag wurden wir von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert. Nach 5 Wochen war ich dermaßen ausgehungert, dass ich als arbeitsunfähig eingestuft wurde. Danach gab es die ein oder andere Schale Wassersuppe zusätzlich und nach weiteren 14 Tagen galt ich wieder als arbeitsfähig.
Ich wurde zum Minenräumen entlang der Oder eingeteilt. Das war ein echtes Himmelfahrtskommando. An meinem 18. Geburtstag sollte ich wieder Minen entschärfen, hatte aber ein sehr ungutes Gefühl. Der Arzt gab mir den Tipp, Tabak zu kauen. Kurz darauf stellte sich Fieber ein, der Arzt schrieb mich krank und ich konnte meinen 18. Geburtstag auf einer Darre bei herrlichstem Sonnenschein genießen. Der Anblick von Minenopfern war furchtbar und blieb mir wenigstens an diesem Tage erspart. Noch Jahre nach dem Krieg wachte ich nachts schweißgebadet auf und hatte Albträume. Wir rückten mit 400 Mann im August 1945 zum Einsatz aus und im November , als ich an Typhus erkrankte, waren noch 200 übrig.
Vor Weihnachten 1945 wurden wir in einem Bauernhof in Brandenburg als gesundet untergebracht. Wir wollten fliehen, um der Kriegsgefangenschaft in Russland zu entgehen. Zwei Mädels halfen uns, meinem Freund und mir dabei und versteckten uns auf dem Hof. Am nächsten Tag versuchten wir den Zug nach Berlin zu nehmen. Wir hatten weder Papiere noch Geld. In Berlin angekommen, erfuhren wir von einer Austauschstelle, die russische und amerikanische Gefangene austauschte. Mein Freund hatte noch die notwendigen Papiere. Ich hatte gar nichts, ich war sozusagen nicht existent. Trotzdem gelang es mir irgendwie, es war zwei Tage vor Weihnachten, mit in den Zug zu kommen. In Moschendorf angekommen, dort befand sich das Lager, war das erste die Desinfektion unserer Körper. Wir wurden mit DDT dermaßen eingesprüht, dass es zu den Hosenbeinen und unseren Ärmeln in dicken weißen Wolken heraus qualmte. Wir hatten Läuse, Wanzen und weiß der Teufel noch was alles. Wenige Tage später fuhren wir mit dem Zug über Hof nach München und weiter nach Ulm. Von dort war es nicht mehr weit zu meines Kumpels Heimatdorf. Dabei mussten wir die französische Zonengrenze überwinden. Die Kontrollen waren als sehr streng bekannt und wer ohne Passierschein erwischt wurde, dem drohte ein Aufenthalt in dem damals für seine unmenschlichen Zustände für Gefangene berüchtigten Marseille. Wir versteckten uns unter dem Zugwagen und warteten erfolgreich ab, bis die Kontrolle vorbei war. Am Hof angekommen, verbrachten wir dort einige Wochen. Im nächsten Monat erreichte mich ein Schreiben, wonach sich alle ehemaligen Wehrmachtsangehörigen bei der französischen Kontrolle zu melden hatten zwecks Personenkontrolle. Wir hatten keinen Entlassungsschein. Als ich berichtete, dass ich aus Oberschlesien kam und dass mir die Polen sämtliche Dokumente weggenommen hatten, und dies mit einer eidesstattlichen Versicherung beurkundete, hatte ich meinen ersten und einzigen Meineid geleistet. 14 Tage darauf erhielt ich meinen Entlassungsschein von den Franzosen per Post. Zum Glück fand ich über das Rote Kreuz nach einigen Monaten meine Mutter wieder. Diese konnte mir eine Kopie meiner Geburtsurkunde schicken. Nur durch dieses Dokument erhielt ich eine Kennkarte. Ich war endlich wieder existent, endlich wieder ein Mensch in der Gesellschaft.
Wir konnten von Kattowitz bis Gleiwitz, vergleichbar der Strecke von Würzburg bis nach Heidelberg, mit der Straßenbahn fahren. Straßenbahnschaffner gab es sehr selten, es waren fast alles Frauen. Wenn wir Zeit hatten, sind wir damals Straßenbahn gefahren, von einer Station zur anderen. Für 10 Pfennig kauften wir uns einen Fahrschein und fuhren lange Strecken. Immer mit verliebten Blick zur Schaffnerin. Es gab auch einen Schlager mit dem Textanfang: „Liebe, kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag wo fährt dein Wagen hin …“.
Danach gab es die sogenannten „Politischen Ehefrauen“. Es wurde darauf gedrungen, dass Mädchen aus anderen Regierungsbezirken mit Soldaten Verbindung aufnahmen. Es war so eine Art Feldpostpatenschaft. Wir schrieben an die Schule in irgendeiner Stadt. Bei mir war es eine Oberstufenklasse in Berlin- Zehlendorf. Eines Tages kam ein Brief : Lieber Flakhelfer, Lieber Günter. ….. Daraus entwickelte sich eine Brieffreundschaft, dann wurden Bilder ausgetauscht und ich lief wie viele andere stolz durch die Gegend mit dem Bild meiner „Politischen Ehefrau“, die ich nie zu Gesicht bekommen hatte. Meine „Ehefrau“ war Waldtraut Liebe, eine Zahnarzttochter aus Berlin. Das war schon eine Art Heiratsvermittlung, und der ein oder andere Soldaten führte später seine Feldpostfreundin auch tatsächlich vor den Traualtar. Das ganze diente der moralischen Aufrüstung der Soldaten. Die Heimat sollte sich um die Frontsoldaten kümmern. Feldpost und Bücher fanden so den Weg an die Front. Und in mancher schweren Stunde halfen uns die Briefe unsere Brieffreundinnen, die wir doch gar nicht kannten. Brieffreundschaften wurden auch durch die Soldatensender im Radio publik gemacht. Ich habe das Mädchen, wie gesagt, nie persönlich gesehen und nach dem Krieg habe ich auch keine Verbindung zu ihr gehabt. Das ganze lief ähnlich wie heute das Chatten im Internet oder Kontaktbörsen ab. Es war jedoch wesentlich intensiver und emotionaler. So hat diese Kriegszeit viele schwere und harte Episoden gebracht. Es gab aber auch immer wieder schöne Dinge. Alles das hat mein Leben danach beeinflusst und viele Entscheidungen begründet.
Artikel: Günter Pasternok






Materialien für Lehrer und Schüler



- Alle Abi-Materialien auf einen Blick: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/abi-vorbereitung/ und Power-Paket für Abi-Kämpfer: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/gesamt-strategie-fuer-abi-kaempfer/
- „Die Stillen in der Schule“ – Ermutigung + Strategien bei Introversion – zum Lesen, Ausdrucken und Anhören: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/die-stillen-in-der-schule-1-vom-glueck-der-introversion/
- „Jugend im Selbstspiegel“ – eigene Texte mit Zeichnungen, präsentiert in einer öffentlichen Lesung: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/der-mensch-mit-dem-schizophren-denkenden-herzen-und-der-verwirrten-seele/
- „Handy, Schule und unser Gehirn“, neurologisch-psychologische Forschungsergebnisse in Blick auf Handys und soziale Medien: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/alle-vorsaetze-sind-fuer-den-arsch-wenn-man-sich-nicht-daran-haelt/
- „Handyverbot an Schulen – und wir haben ein Problem weniger!“: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/handyverbot-an-schulen/
- „Die Macht der Disziplin“ – diszipliniert → erfolgreicher, stressfreier und glücklicher: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/disziplin-erfolgsfaktor-in-der-schule-einfuehrung/
- „Schülerzeitungsermutigung“ (22 Artikel) – Rückblick, Tipps und Strategien für Schüler-Freiraum: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/redaktionsgroesse-zwei-pizza-regel/
- „Faule Säcke, werdet Lehrer!“ – billiger Populismus gegen den Lehrerberuf durchs Kultusministerium: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/faule-saecke-aller-laender-werdet-lehrer-in-baden-wuerttemberg/